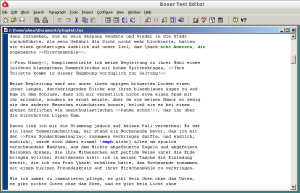Leider hier gerade ziemlich viel um die Ohren, so dass es derzeit nicht für einen „vernünftigen“ Post reicht… Ich bitte um Entschuldigung!
Monat: April 2014
Making of… Murder (5)
Ungefähr um die gleiche Zeit, also in der Ära der Korrekturen, erwartet einen Autor eines „Mittagspausenverlags“, wie das mein Verleger so nett nennt, auch eine wesentlich angenehmere Aufgabe.
Größere (darf man es sagen? — „professionellere“ ;-)) Verlage haben natürlich ihre eigenen Künstler für die Anfertigung von Covern und ihre eigenen Vorstellungen davon, wie die auszusehen haben. Bei Knurrhahn lässt Thomas seinen Autoren (in einem gewissen Rahmen) freie Hand für das Design der Umschläge, und ich habe hier das Glück, mit Johanna Lawrence zusammenarbeiten zu dürfen, die bereits das Cover für „Zita S.“ angefertigt hat und auch für das Äußere des „Einsamen Goldfischs“ verantwortlich zeichnet.
Es ist sehr angenehm, dass Johanna und ich auf „einer Wellenlänge“ sind. Während es bei „Zita S.“ noch eine ganze Zeitlang gedauert hatte, bis wir uns auf eine Idee einigen konnten, die uns beiden gefiel, kamen wir beim „Goldfisch“ jetzt fast unabhängig voneinander zu dem Schluss, dass wir das Architektur-Motiv beibehalten sollten, um den Wiedererkennungswert zu steigen, und dass nur eben ein etwas anderes Farbschema und natürlich auch eine andere Fassade zum Einsatz kommen sollten.
Ich finde Johannas Entwürfe wiederum sehr gelungen.
Making of… Murder (4)
Irgendwann ist die Rohfassung des Manuskripts soweit fertig. Während die Erstellung des Konzepts und des Textes recht entspannte und angenehme Arbeiten waren, geht es nunmehr ans Tüfteln.
Dann vieles, was mir beim Tippen wie eine Offenbarung der Literatur vorkam, ist das natürlich nicht mehr, wenn man etwas unvoreingenommen und mit Abstand auf das Manuskript schaut. Darum gilt es nach dem Entwurf, noch einmal mit selbstkritischem Auge und spitzem und unermüdlichem Bleistift über die Seiten zu gehen und einmal mehr die Geschichte so zu lesen, als lese man sie zum ersten Mal — und als sei nicht schon seit Monaten der Großteil meiner Gedankengänge nur um die Handlungsstränge und Formulierungen dieser Geschichte gewunden gewesen.
An diesem Zeitpunkt kommt dann auch der beliebte Sport des „Kill your darling“ ins Spiel. Es ist eines der grausamen Spiele der Literatur, dass man selber häufig Ideen hat, die man nicht nur für gut hält, sondern die eigentlich auch wirklich gut sind — aber eben nur „eigentlich“, und leider nicht in der konkreten Situation, in der man sie verwenden wollte. Noch leiderer bietet sich oft überhaupt keine Situation, in der man die Idee einbringen könnte. So muss man sie dann schweren Herzens mit einem spitzen Skalpell aus der Geschichte herausschneiden. Wenn auch die Idee über den Bach geht, so ist es doch zum Wohl des ganzen Buches.
Das macht keinen großen Spaß, vor allem nagt es einerseits am Selbstvertrauen, andererseits sollte man natürlich auch nicht soweit gehen, alles und jeden über den Haufen zu werfen. Vielleicht das Schlimmste daran ist, dass, wenn man sich selbst mit seinem Manuskript dem reinigenden Fegefeuer unterworfen hat und geläutert daraus hervorkommt — dass dann in einer zweiten Runde das ganze Spiel noch einmal von vorne beginnt, und der Lektor bzw. Verleger seine Anmerkungen zum Text hat…
Making of… Murder (3)
Zwischendurch muss man ab und zu die Leserschaft mit Blogposts bei Laune halten.
Making of… Murder (2)
Nachdem die Vorarbeiten soweit gediehen sind, geht es ans eigentliche Schreiben. Das ist der kreative Prozess per se, und als solcher eine der schwierigsten Etappen in der Entstehung des Buches. Immerhin soll der Autor, der sich ja nun schon seit Wochen und Monaten mit dem Thema befass hat, den Text, wenn er ihn niederschreibt, so betrachten wie ein Leser, der zum allerersten Mal damit konfrontiert wird: Welchen Eindruck wird diese oder jene Szene auf ihn machen? Wie kann ich diese und jene Stimmung erzeugen, wie den besonderen Sachverhalt einführen? (Insbesondere bei einem Krimi idealerweise so, dass ich das Ende nicht gleich verrate…) Und schließlich, welche Pointen, bei deren Erfindung ich mich bepisst habe vor Lachen, werden beim Leser nur ein schwaches Gähnen hervorrufen?
Nun kommt natürlich auch die Phase, in der sich zeigt, dass die im Treatment angelegte Geschichte vielleicht nicht die optimale Lösung war. Autoren wie Stephen King zum Beispiel nehmen ihre Treatments eigentlich nur als grobe Richtlinie und erlauben den Figuren, wie sie ihrer Phantasie beim Schreiben tatsächlich entspringen, größere Freiheiten und schreiben schon mal drauf los, ohne sich wirklich auf ein Ende festgelegt zu haben. Ich persönlich (ohne mich sonst mit Stephen King vergleichen zu wollen) halte mich meist recht genau an das Treatment, allerdings auch nicht sklavisch: Beim Goldfisch z.B. war vorgesehen, dass der nächtliche Überfall mit einer weiteren Leiche endet. Als ich an die entsprechende Stelle kam, wurde mir allerdings bewusst, dass das für die leichte „sommerliche“ Stimmung, die die Geschichte ansonsten durchzog, nicht recht angemessen gewesen wäre. So kam also niemand an dieser Passage zu Tode, was mir außerdem auch noch erlaubte, einen netten kleinen Twist am Ende der Geschichte einzufügen.
Da ich ein recht altmodischer Mensch bin, schreibe ich nicht mit Word. Ich empfinde diese Textverarbeitung als so ziemlich die schlechteste vorstellbare Lösung, um etwas anderes als Einladungen zum Kindergeburtstag zu tippen. Leider stehe ich mit meiner Meinung relativ alleine dar, und so auch mit meiner Vorliebe für „LaTeX“, mit dem ich stattdessen meine Texte schreibe. LaTeX ist keine „What-You-See-Is-What-You-Get“-Anwendung, stattdessen werden Texte mit LaTeX in einer „Auszeichnungssprache“ geschrieben, die eher an HTML erinnert. Soll ein Textabschnitt beispielsweise hervorgehoben werden, so wird er in geschweifte Klammern eingefasst und ihm der Befehl „emph“ (für „emphasis“) vorangestellt: „emph{Betone mich!}“
Beim „Drucken“ wird von LaTeX aus diesen Quelltexten ein PDF- oder anderes Dokument generiert. Und zu diesem Zeitpunkt sieht LaTeX an einer ganz anderen Stelle nach, was „emph“ denn eigentlich bedeutet — ob die Schrift kursiv, fett oder vergrößert dargestellt werden soll. Das ist alles in weitem Rahmen durch den Anwender einstellbar, aber der große Vorteil ist, dass ich nur zu schreiben brauche „emph“ und bereits weiß, dass jeder Text mit dieser Auszeichnung nachher gleich aussehen wird, und ich mir über ein einheitliches Aussehen meines Dokuments keine Gedanken mehr zu machen brauche.
Weitere Vorteile sind, dass LaTeX kostenlos und für jede Plattform erhältlich ist. Die Quelltexte können mit jedem Editor auch auf altersschwachen Rechnern bearbeitet werden, und vor allem ist die Typographie und das Erscheinungsbild von mit LaTeX erstellten Dokumenten allem, was Word generieren kann, weit überlegen.
Der einzige Nachteil ist, dass LaTeX keine Word-Dokumente erzeugen kann — weswegen die Zusammenarbeit mit anderen, wie zum Beispiel Verlegern, gelegentlich Klimmzüge erfordert.